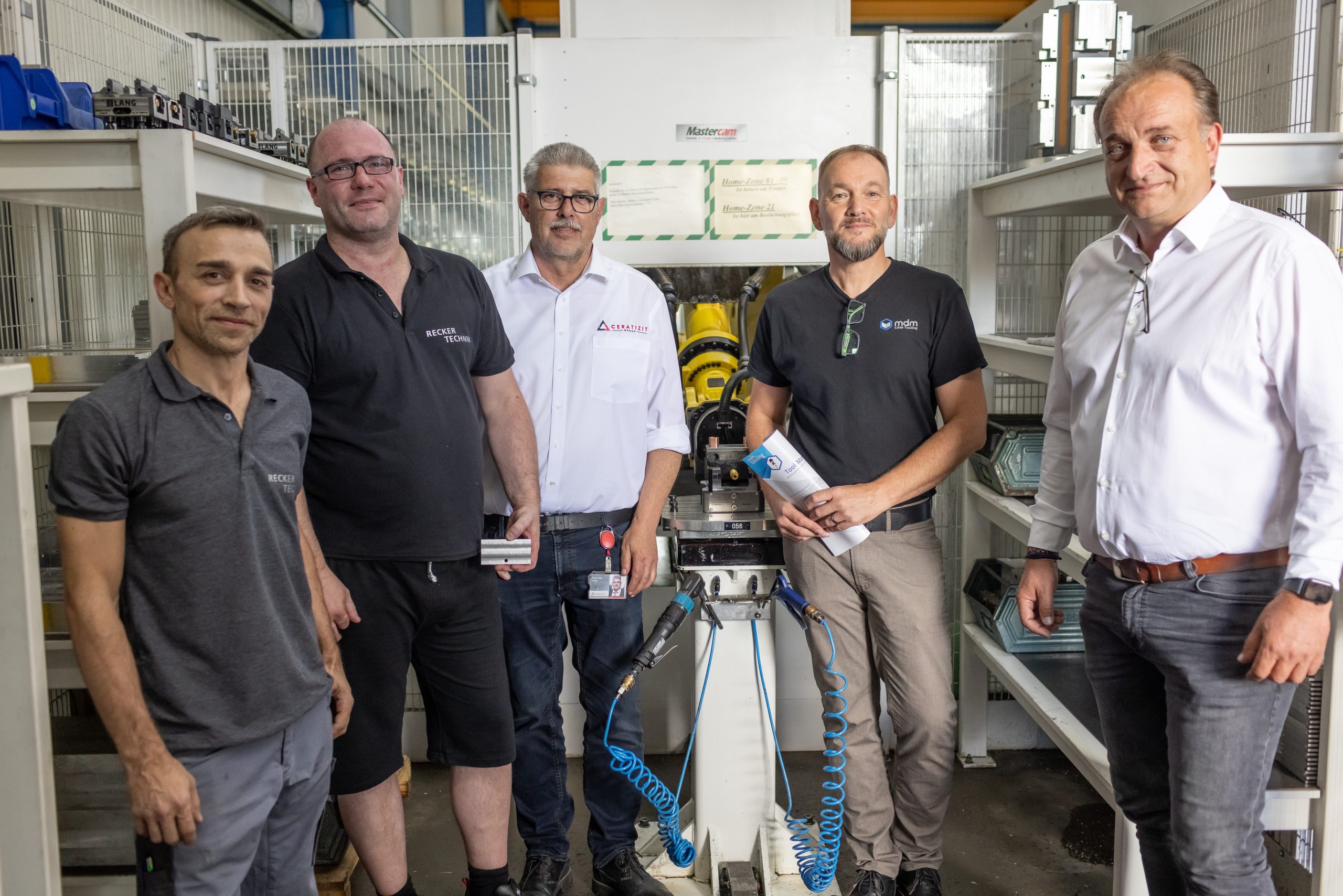Im Anhang I der Maschinenrichtlinie (MRL) sind im Abschnitt 1.2.5 die Anforderungen an einen Betriebsartenwahlschalter an Maschinen beschrieben. Hier sind zum einen die Bestimmungen bezüglich der Risikoreduzierung bei Arbeiten mit abgeschalteten oder geöffneten Schutzeinrichtungen enthalten, wie beispielsweise eine Reduktion der Arbeitsgeschwindigkeit. Aber auch, dass der Betrieb nur erlaubt ist, solange eine Befehlseinrichtung betätigt wird. Zum anderen findet man aber auch Hinweise darauf, wie eine Betriebsartenwahleinrichtung gestaltet sein soll. Beim Einsatz eines Betriebsartenwahlschalters wird gefordert, dass entweder die Betriebsart in jeder Stellung abschließbar ist oder aber der Zugang auf einen bestimmten ausgebildeten Personenkreis beschränkt wird. Letzten Endes ist bei beiden Methoden der Hintergrund, dass nicht jedermann Zugang zur Umschaltung der Betriebsart bekommt. Der Nutzerkreis soll beschränkt auf ausgebildetes Personal sein. Häufig findet man zu diesem Zweck Schlüsselschalter oder auch Passwörter in der Steuerung. Beide Systeme weisen jedoch Nachteile auf. Beim Schlüsselschalter bleibt der Schlüssel sehr häufig eingesteckt, sodass die eigentliche Wirkung verloren geht. Das gleiche gilt natürlich auch für Passwörter. Diese sind nach kurzer Zeit allgemein bekannt oder sogar auf einem Zettel direkt an der Maschine notiert. Beide Fälle sind aus der Praxis wohlbekannt und somit vorhersehbar. Mit einem elektronischen Zugriffs- und Verwaltungssystem, wie dem EKS von Euchner, kann der Zugang zur Betriebsartenwahl in einer einfacheren und sicheren Art und Weise realisiert werden.
Das Electronic Key System EKS
Das EKS ist ein einfaches und bewährtes System, welches aus einem elektronischen Schlüssel und einer passenden Schlüsselaufnahme besteht. Die Datenübertragung erfolgt kontaktlos vom Schlüssel zur Schlüsselaufnahme. Hierfür verfügt der Schlüssel (Electronic-Key) über einen Speicherchip und einen Transponder. Die kompakte Schlüsselaufnahme ist eine Schreib/-Leseeinheit mit integrierter Schnittstellenelektronik. Abhängig vom gewählten EKS kann dieses entweder über einen Bus oder mittels digitaler Ausgänge an Steuerungen oder auch Sicherheitsauswertungen angeschlossen werden. Für das EKS ist eine passende Schlüsselverwaltungssoftware erhältlich, der Electronic Key Manager EKM. Mit diesem Programm können die einzelnen Schlüssel individuell beschrieben und Freigaben hinterlegt werden.
Schlüsselschalter versus EKS
Nun stellt sich beim EKS natürlich die Frage nach dem Grad der Sicherheitstechnik. Aber diese stellt sich ebenso bei einem Schlüsselschalter oder bei einem Passwort. Um diese Frage beantworten zu können, wird das EKS in einer Analogie zu einem Schlüsselschalter betrachtet. Der EKS-Schlüssel entspricht dem konventionellen mechanischen Schlüssel eines Schlüsselschalters. Das Lesen der Daten vom Schlüssel mit der EKS-Schlüsselaufnahme und die Auswertung, ob es die richtigen Daten sind, entspricht dem Schließzylinder. Nur wenn die Daten korrekt sind, wird eine Freigabe erteilt, so wie bei einem Schließzylinder der Schlüssel passen muss. Die Elemente Schlüssel und Schließzylinder des Betriebsartenwahlschalters müssen keine Sicherheitsanforderung im Sinne der Maschinenrichtlinie erfüllen, denn sie dienen nur als Zugang zum Betriebsartenwahlschalter. Deshalb muss auch das EKS keine Sicherheitsfunktion erfüllen. Der Schlüsselschalter hat durch das Drehen des Schlüssels gleichzeitig die Funktion der Auswahl der gewünschten Betriebsart. Diese kann dann einkanalig oder zweikanalig ausgeführt sein und erfüllt damit auch eine Sicherheitsfunktion im Sinne der MRL. Eine solche Funktion wird vom EKS in der Ausführung EKS FSA (für sichere Applikationen) erfüllt. In jedem Fall muss ein sicheres Auswertegerät bzw. eine Logik nach EN ISO13849-1 ergänzt werden, um eine vollständige Sicherheitsfunktion mit Eingang, Logik und Ausgang zu erhalten. Eine Applikation für das EKS FSA erfüllt PL d, welcher durch ein Zertifikat der BG bestätigt wird.
Unterteilung der Betriebsartenwahl in Security und Safety
In einem Arbeitskreis mit Teilnehmern der BG, Maschinenherstellern, Endanwendern und Herstellern von sicherheitstechnischen Geräten wurde ein Papier erarbeitet, welches diese Thematik umfassend behandelt (Infoblatt \’Sicherheitsbetriebsarten an Werkzeugmaschinen\‘). Basis der Betrachtung ist die Unterteilung der Betriebsartenwahl in drei Teile. Bild 2 beschreibt diese Unterteilung für die Beurteilung der sicherheitsrelevanten Teile. Der Bereich Security erfüllt mit dem Zugangssystem nur die Beschränkung auf einen bestimmten Personenkreis. Dieser Teil muss keine Sicherheitsfunktion im Sinne der funktionalen Sicherheit für Maschinen erfüllen. Die Sicherheitsfunktion selbst ist für das Auswahlsystem und das Aktivierungssystem zu beurteilen. Das Auswahlsystem besteht beispielsweise aus Tasten, die in einer 1 aus n Funktionen in der Sicherheitstechnik ausgewertet werden. Das Aktivierungssystem ist derjenige Teil der Betriebsartenwahl, der innerhalb der Steuerungsebene verarbeitet wird. Dies ist z.B. dann relevant, wenn ein Benutzer die Betriebsart ändert, die Maschine jedoch noch in der Abarbeitung eines Zyklus ist und eine sofortige Umschaltung zu einer höheren Gefährdung führt, als das Fertigstellen des Arbeitsschrittes. Die beschriebene Unterteilung in Security und Safety wird sich in Zukunft in vielen C-Normen wiederfinden, denn diese Interpretation der Forderungen der Maschinenrichtlinie erleichtert an vielen Stellen die Ausführung und Beurteilung der Betriebsartenwahl erheblich. Im Verlauf der Arbeit am oben genannten Infoblatt \’Sicherheitsbetriebsarten an Werkzeugmaschinen\‘ wurde auch festgestellt, dass bezüglich des Begriffs Betriebsart eine Sprachverwirrung besteht. Es wurde derselbe Begriff sowohl für eine bestimmte Betriebsart als auch für unterschiedliche Betriebsarten verwendet, ebenso wie unterschiedliche Begriffe für denselben Sachverhalt verwendet wurden. Aufgrund dieser Erkenntnis wurde der Versuch unternommen, eine Ordnung in diese Begriffsvielfalt zu bringen. Dies geschah auch in Übereinstimmung mit der bereits bestehenden Norm für Drehmaschinen (EN ISO23125), die ebenfalls eine erste Ordnung in diese Begriffsvielfalt gebracht hat. Übergeordnet wurde der Begriff \’Sicherheitsbetriebsart\‘ definiert, um klar zu machen, dass es sich in erster Linie um eine Umschaltung im Sinne der Sicherheit handelt, denn üblicherweise sind die verschiedenen Betriebsarten einer Maschine durch unterschiedliche Risikoniveaus gekennzeichnet. In der oben genannten Norm sind insgesamt vier verschiedene Sicherheitsbetriebsarten genannt:
- Betriebsart 0: Manueller Betrieb
- Betriebsart 1: Automatikbetrieb
- Betriebsart 2: Einrichtbetrieb
- Servicebetrieb
Die kommende Norm für Fräsmaschinen erweitert diese um die Betriebsart \’Automatik mit manuellem Einlegen\‘. Dementsprechend wird sich pro Maschinentyp ein anderer Umfang an Betriebsarten wiederfinden. Z.B. werden es bei Pressen deutlich weniger sein. Alle Betriebsarten haben gemeinsam, dass das Risikoniveau innerhalb einer Betriebsart immer gleich bleibt, unabhängig davon, ob z.B. bei einer Betriebsart \’Einrichten\‘ die Funktion Einzelschritt mittels eines Zustimmttasters oder aber durch reduzierte Geschwindigkeit der Spindel realisiert wird. Am verwirrendsten, bei den bisher für die Betriebsarten verwendeten Begriffen war, der Begriff \’Einrichten\‘. Dieser stand sowohl für eine Betriebsart als auch für die Funktion \’Einrichten\‘. Nach einer Eingruppierung der Begriffe wurde dessen Bedeutung klar.
Betriebsartenwahlschalter basierend auf dem EKS
In der Praxis sieht ein auf dem EKS basierenden Betriebsartenwahlschalter so aus, dass die Daten auf dem Schlüssel des EKS in der konventionellen Steuerung der Maschine ausgewertet werden. Die Steuerung regelt somit den Zugang zum Betriebsartenwahlschalter. Die eigentliche Auswahl der Sicherheitsbetriebsart erfolgt dann über ein zusätzliches Tastenfeld. Dieses wiederum wird entsprechend des geforderten PL von einer sicheren Logik ausgewertet (Bild 4). Diese Art des Aufbaus bietet mehrere Vorteile:
- Auf nur einem einzigen EKS-Schlüssel können beliebig viele Maschinen mit unterschiedlichen Berechtigungen gespeichert werden, dadurch wird pro Mitarbeiter nur ein einziger Schlüssel benötigt.
- Der EKS-Schlüssel kann neben dem Zugang zur Betriebsartenwahl auch weitere Berechtigungen enthalten.
- Das Auswahlsystem zur Anwahl der Sicherheitsbetriebsart ist frei wählbar und kann z.B. in das Tastenfeld der Maschine integriert werden.
- Die Beschriftung der Tasten ist entsprechend den Vorgaben der Norm, die zur Anwendung kommt, frei wählbar.
- Die Zugangssicherheit zum System ist wesentlich höher als mit Schlüsselschaltern:
- Die Daten des Zugangs können protokolliert werden.
- Ein Kopieren eines Schlüssels kann zuverlässig verhindert werden.
- Schlüssel können gesperrt werden.
- Jeder Schlüssel kann personalisiert werden, da er einmalig ist.
Da auf jedem EKS-Schlüssel eine einmalige Kennung ist, kann dieser als persönlicher Schlüssel an jeden berechtigten Mitarbeiter herausgegeben werden. Das führt verglichen mit einem konventionellen Schlüssel dazu, dass die Verantwortung für diesen an eine Person übertragen werden kann, da die Möglichkeit einer Identifizierung gegeben ist. Natürlich müssen hierzu die Zugänge zum System protokolliert werden. Typischerweise wird damit erreicht, dass die Schlüssel nach Gebrauch abgezogen werden und nicht an der Maschine verbleiben. Somit wird das Risiko, dass eine unbefugte Person Zugang hat, vermindert. Auch ein Sperren eines Schlüssels wird möglich, da jeder einzelne Schlüssel ein Unikat darstellt. Dies ist insbesondere in Verbindung mit dem Electronic Key Manager EKM, der Verwaltungssoftware für EKS-Schlüssel, möglich. EKM ist ein frei programmierbares Datenbanksystem zur Verwaltung von EKS-Schlüsseln. Im EKM sind alle Besonderheiten, die der EKS-Schlüssel bietet, bereits integriert. Es kann in einer Client-Server-Umgebung auf mehreren Rechnern oder als Einzelplatzlösung betrieben werden. Das Kopieren eines Schlüssels wird dadurch verhindert, dass eine Prüfsumme auf den Schlüssel geschrieben wird, die nicht einfach von einem anderen Schlüssel kopierbar ist, selbst wenn sich jemand die Möglichkeit zur Programmierung eines Schlüssel verschafft. Letzten Endes wird mit dem EKS die Betriebsartenwahl deutlich sicherer, da der Zugang zur Auswahl wesentlich besser, als mit einem Schlüsselschalter oder gar mit einem Passwort, gesichert ist.
Hoher Schutz im Servicebetrieb
Durch diese Art des Zuganges ist es Maschinenherstellern möglich, die zumeist besonders gefährliche Betriebsart \’Servicebetrieb\‘ zu installieren. Somit kann den Mitarbeitern ein hohes Maß an Schutz übergeben werden. Die Servicetätigkeit selbst wird hiermit ohne eine Manipulation eines Sicherheitsbauteils realisiert. Eine weitere Forderung aus der Maschinenrichtlinie ist, dass ein Betriebsartenwahlschalter in jeder Stellung abschließbar sein muss. Diese Forderung erfüllt ein Schlüsselschalter in sich durch die Art seines Aufbaus, sofern der Schlüssel in jeder Position abziehbar ist. Beim EKS wird diese Funktionalität in der sicheren Auswertung durch entsprechende Programmierung oder Verdrahtung realisiert. Allerdings hat es häufig sicherheitstechnisch auch Vorteile, den Schlüssel gesteckt zu lassen. Durch den gesteckten Schlüssel wird eindeutig signalisiert, dass eine besondere Arbeit an der Maschine durchgeführt wird. Solange der Schlüssel steckt, liegt die Verantwortung für den Betrieb der Maschine beim Besitzer des gesteckten Schlüssels. Sobald der Schlüssel abgezogen wird, muss die Maschine in den sicheren Betrieb zurückfallen. Das ist typischerweise der Automatikbetrieb, in dem Maschinenbewegungen nur möglich sind, wenn alle sicherheitstechnischen Einrichtungen in Funktion und aktiv sind. Die MRL lässt auch diese Lösung zu, denn die Forderung \’Abschließbar in jeder Stellung\‘ kann auch durch andere geeignete Lösungen ersetzt werden. Letzten Endes muss diese Entscheidung der Konstrukteur einer Maschine selbst fällen und die Beurteilung entsprechend dem geringsten Risiko wählen. Eine Manipulation an gleich welcher sicherheitstechnischen Anlage ist auf jeden Fall ein hohes Risiko.