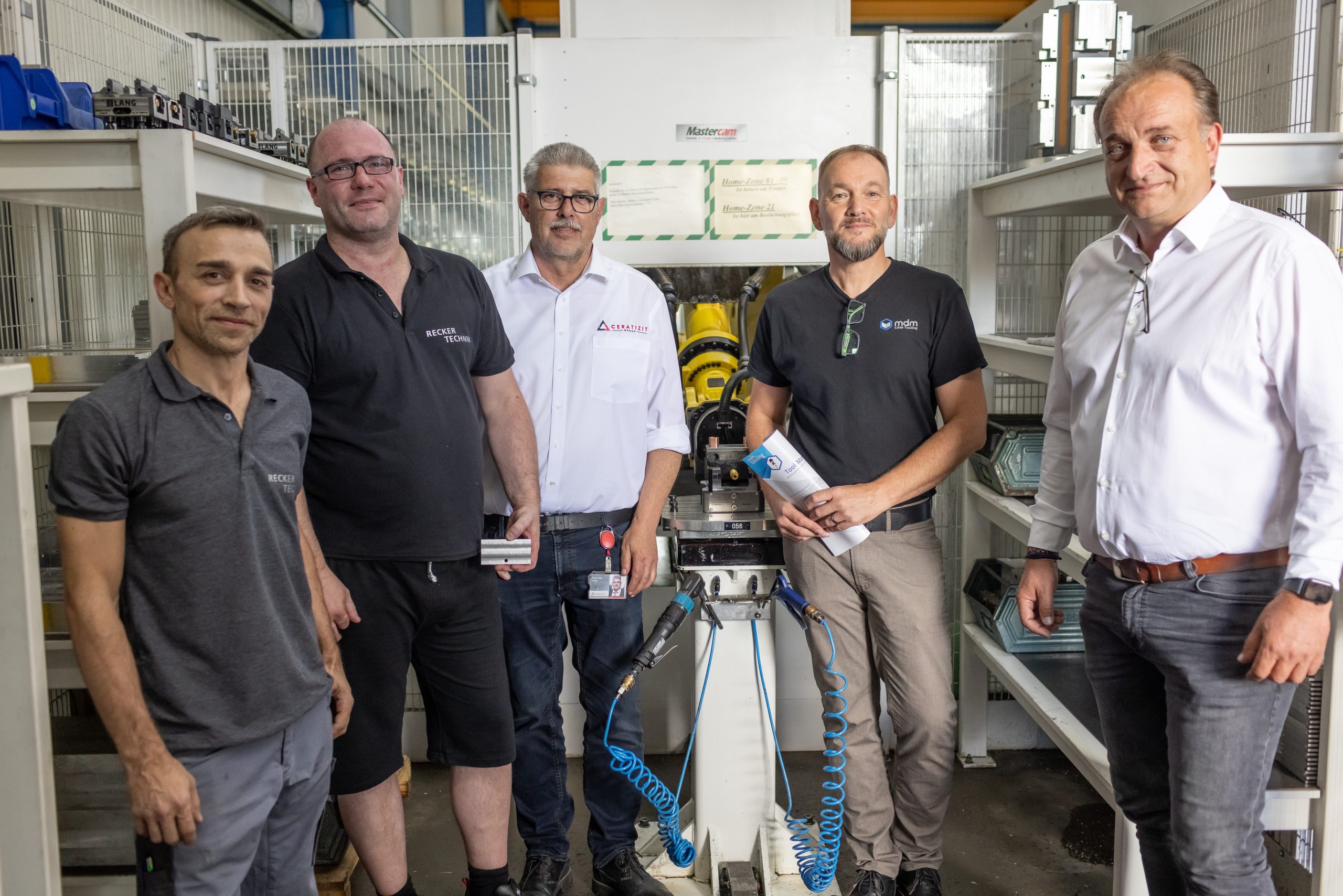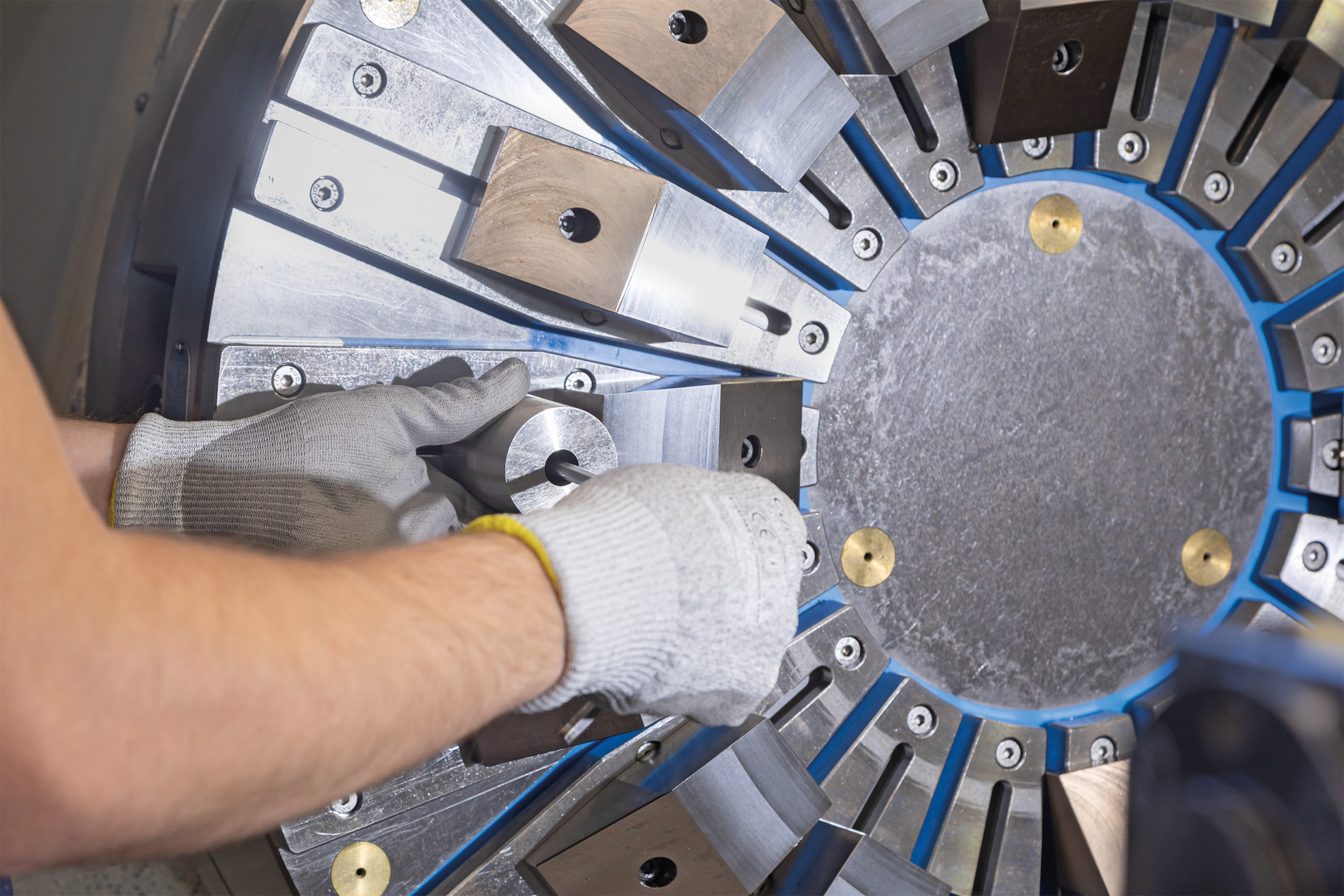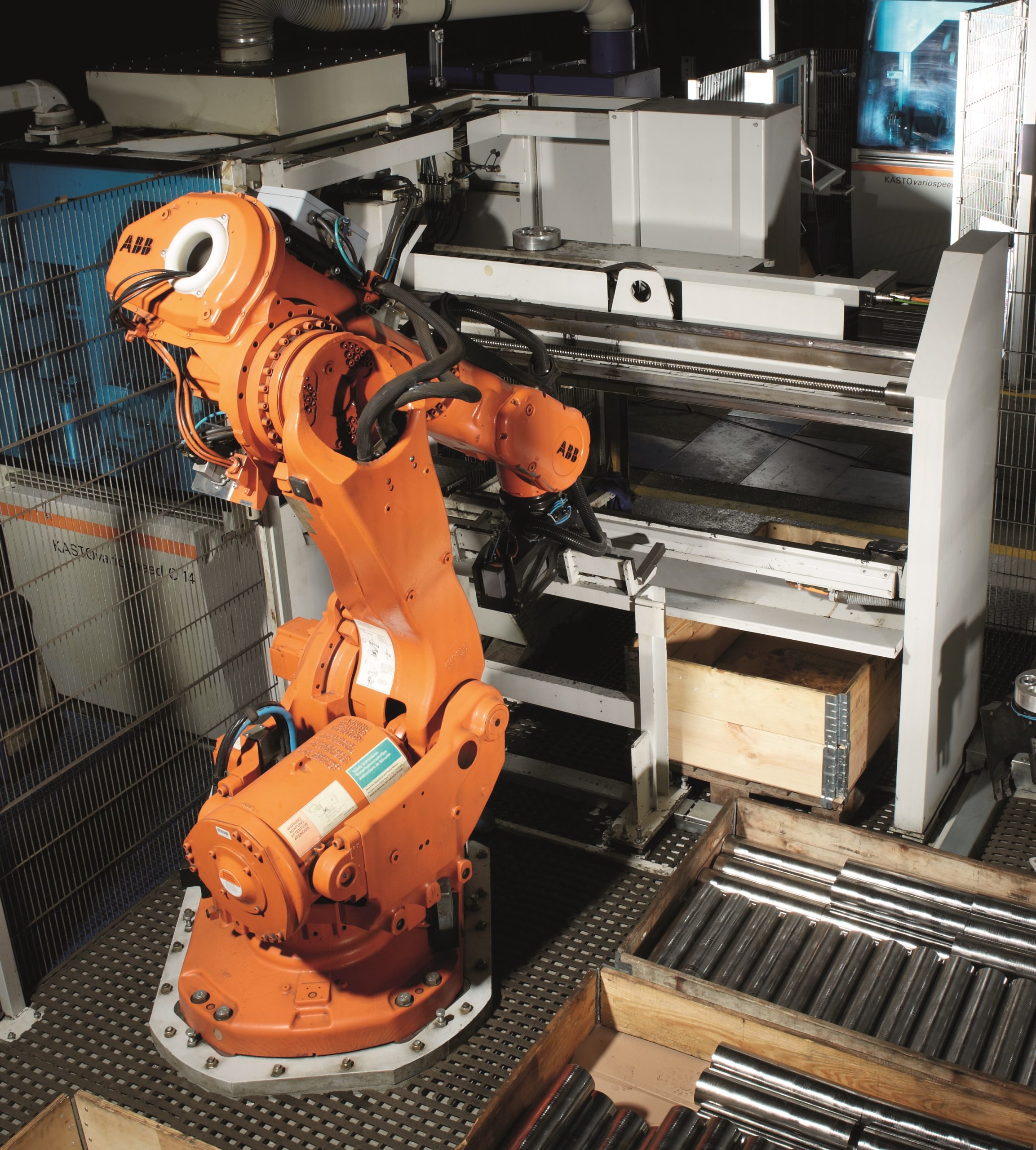Der Analyser AutoSPy – dessen neue Version 3.0 gerade veröffentlicht wurde – ist solch ein Werkzeug, das für die schnelle Erfassung und Auswertung von Prozessdaten zur Fehlerdiagnose oder Optimierung von Automatisierungsanlagen entwickelt wurde. Er ermöglicht die zyklusgenaue Datenerfassung von Simatic SPSen von Siemens und hilft so den Anwendern dieser Controller, den wahren Verursacher eines Problems zu bestimmen. Insbesondere eine Überlagerung mehrerer Fehlerquellen führt zu sporadischen oder transienten Anlagenstörungen, deren Diagnose solch ein spezielles Messverfahren erfordert.
Zyklusgenaue Datenerfassung
Die zyklusgenaue Datenerfassung liefert in jedem SPS-Zyklus genau einen Datensatz der Signale, die der Anwender zuvor festgelegt hat (Bild 2). Dies wird erreicht, indem während des laufenden Betriebs der Anlage eine Monitoring-Applikation aus Code-Bausteinen und einem Datenpuffer von AutoSPy generiert und vor der Aufzeichnung zusätzlich zur Steuerungsapplikation in die SPS übertragen wird. Dem OB1, dem Interrupt-Handler der Hauptschleife, wird ein Aufruf des generierten Messprogramms vorangestellt, um es in die zyklische Programmbearbeitung einzubinden. Die Analysebausteine beinhalten die eigentliche Aufzeichnungsfunktionalität. Sie schreiben in jedem Zyklus die Zustände der ausgewählten SPS-Operanden wie Eingänge, Ausgänge oder Merker in einen Ringpuffer aus Datenbausteinen, dessen Größe einstellbar ist. Während der Aufzeichnung fragt der Analyse-PC den Zustand dieses Puffers ab, überträgt alle gefüllten Datenbausteine in das Datenarchiv auf seiner Festplatte und gibt die gelesenen Bereiche des Puffers zum erneuten Beschreiben frei. Zugleich werden die neuesten Daten zur Anzeige gebracht. Hält die Aufzeichnung an, macht die Software alle Änderungen am Programm der SPS wieder rückgängig. Mit diesem Verfahren erreicht man eine hohe Messgenauigkeit und kann garantieren, dass kein Zyklus bei der Datenerfassung übersprungen wird. Die Abtastrate kann jedoch nicht vorgegeben werden, sondern hängt unmittelbar von der Zykluszeit der Steuerung ab. Die Aufzeichnung arbeitet also genauso schnell bzw. langsam wie die SPS selbst. Da die jüngeren Controller-Generationen, allen voran die Soft-SPSen, bereits Zykluszeiten im einstelligen Mikrosekundenbereich erreichen, speichert und verarbeitet der Analyser in seiner aktuellen Version alle Zeitstempel auf eine Nanosekunde genau.
Aufzeichnung elektrischer Signale
Trotz der großen Genauigkeit reicht die Sicht von innen manchmal nicht aus, um bestimmte Probleme aufzuklären. Prinzipielle Gründe hierfür können sein, dass eine zusätzliche Prozessgröße benötigt wird, die von der SPS nicht erfasst wird bzw. nur mit großem Aufwand erfasst werden kann, oder dass zwar ein entsprechendes Eingangssignal existiert, dieses aber durch eine höhere SPS-Zykluszeit zu langsam abgetastet wird. Ein typischer Anwendungsfall hierfür sind redundante Kontrollmessungen, wenn der Verdacht eines Sensor- bzw. Baugruppenfehlers vorliegt. Aber auch die Einführung fortschrittlicher Wartungskonzepte (Predictive Maintenance) kann die temporäre Installation zusätzlicher Messstellen erfordern, um zunächst deren Nutzen zur Vorhersage von Ausfallzeitpunkten einer Anlage zu ermitteln. Für solche Aufgabenstellungen lässt sich mit der A/D-Messbox LabJack U12 der Verlauf elektrischer Signale aufzeichnen, z.B. von Schaltern, Lichtschranken, Temperatur- oder Drucksensoren. Die Mess-Hardware wird dazu per USB an den PC angeschlossen und bietet bis zu 20 digitale Eingänge, einen 32-Bit-Zähler sowie bis zu acht analoge Eingänge mit einer Auflösung von 12Bit. Alle digitalen und analogen Eingänge sind mit wenig Aufwand für 24V-SPS-Pegel einsetzbar. Der analoge Spannungsbereich beträgt ±10V im einfachen bzw. ±20V im differentiellen Messbetrieb. Reicht die Signalanzahl einer einzelnen Messbox nicht aus, können mehrere Geräte gleichzeitig verwendet werden. Der zugehörige AutoSPy-Gerätetreiber unterstützt die drei Aufzeichnungsmodi Polling, Stream und Burst – womit Abtastraten bis zu 8.192 Samples pro Sekunde möglich sind.
Mitschnitt von Videosignalen
Beide vorgestellten Aufzeichnungsarten haben eines gemeinsam: Sie erzeugen numerische Zeitreihen, die eine rein abstrakte Sicht auf die Prozesse bieten. Doch um wirklich zu verstehen, was in der Anlage passiert, braucht es manchmal mehr. Ab der Version 3.0 steht deshalb ein neuer Gerätetreiber zur Verfügung, der Videos von DirectShow-kompatiblen Videoquellen wie Webcams und vielen USB-Industriekameras mitschneiden kann. Dies kann helfen, das Anlagenverhalten zu dokumentieren und die numerischen SPS-Signale zu interpretieren. Die aufgezeichneten Videosignale werden als Reihe von Einzelbildern in der Diagrammansicht dargestellt und lassen sich manuell mit den übrigen Signalen synchronisieren. Ein spezielles Andockfenster ermöglicht das Abspielen aufgezeichneter Videos in Echtzeit. Alle erfassten Messdaten, egal von welcher Quelle, werden gemeinsam im Analyser visualisiert. Damit ist der Anwender in der Lage, beliebig viele Signale für schnelle Soll/Ist-Vergleiche übereinanderzulegen, Frequenzen oder Amplituden auszumessen und Stellen im Signalverlauf mit Hinweismarken zu kennzeichnen, die auf die Ursache eines Fehlers hindeuten. Zwar lassen sich mit einem solchen Analysewerkzeug Anlagenstörungen nicht vermeiden, aber ihre zum Teil dramatischen Auswirkungen vermindern.